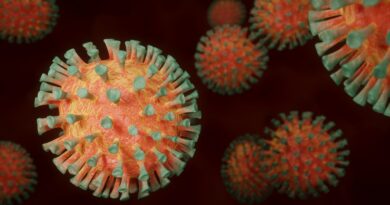„Das THW besteht zu 96 Prozent aus Ehrenamtlichen“ – Interview mit Albrecht Broemme, Ehrenpräsident des THW
Riesige blaue Einsatzfahrzeuge, viele interessierte Menschen und blaue Heldinnen und Helden – das war der Tag der offenen Tür des Technischen Hilfswerk. Bundesweit waren die Türen und Tore des THW für Neugierige geöffnet. Mit Bratwurstgeruch in der Luft und spielenden Kindern auf THW-Bobbycars um einen herum, stellte man sich unweigerlich die Frage: Was ist das Technische Hilfswerk eigentlich? Niemand anderes als Albrecht Broemme, Ehrenpräsident des THW, kann diese Frage so gut beantworten. Er war über Jahrzehnte das Gesicht des Katastrophenschutzes – als Helfer, als Präsident. Nun ist er Ehrenpräsident und Vorsitzender der Stiftung THW. Auf dem 201. jugend presse kongress hielt dieser einen Vortrag über nachhaltigen Katastrophenschutz. Der Kongress fand in Potsdam, im Kongresshotel Potsdam, statt. Hier kamen engagierte Jugendliche aus ganz Deutschland zusammen, um über die Themen des Zeitgeschehens zu diskutieren. Der Kongress wurde von der young leaders GmbH ausgerichtet und vom Bundesministerium für Verkehr gefördert. Neben den Impulsvorträgen wurde auch die schöne Potsdamer Innenstadt erkundet. Im Nachhinein ergab sich folgendes Interview mit Albrecht Broemme, der auch Landesbranddirektor der Berliner Feuerwehr war. Das Interview führte Paul Kiesow, Schüler der 12. Klasse in Hessen.
Herr Broemme, Sie engagieren sich nun schon seit mehr als 50 Jahren beim Technischen Hilfswerk, wie kamen Sie zum THW?
Eigentlich durch einen Tag der offenen Tür. Ich war begeistert, was das THW alles so kann. Damals noch uralte Fahrzeuge, zum Teil alte Geräte, aber das, was man machen konnte, das hat mich schwer beeindruckt. Da habe ich mir gesagt: Sowas möchte ich gerne auch lernen. So hat mich ein Tag der offenen Tür aufs THW aufmerksam gemacht und ich habe dann beim Technischen Hilfswerk angefangen.
Welchen Einsatz beim THW werden Sie niemals vergessen?
Ich werde nie einen Einsatz in Haiti vergessen, einen Auslandseinsatz. Für mich war es so trostlos, nach diesem schweren Erdbeben, zu sehen, wie das Volk auch nicht mehr in der Lage ist, sich selbst zu helfen. Wo auch die Hilfe von außen nur mäßig erfolgreich sein konnte.
Was kann das Technische Hilfswerk, was keine andere Organisation in Deutschland kann?
Der große Vorteil des Technischen Hilfswerks ist, dass das THW im Wesentlichen mit Ehrenamtlichen arbeitet. Also die Einsätze im In- und Ausland werden zu fast 100 Prozent von Ehrenamtlichen bedient, die sich spezialisieren auf die jeweiligen Geräte, mit denen sie arbeiten. Die Feuerwehr ist das Gegenteil. Da muss jeder Feuerwehrmann alles machen können. Wenn ich zum Beispiel ein Notstromaggregat nehme, womit ich ein Krankenhaus einspeisen will, weil die Stromversorgung dort ausgefallen ist, dann muss dort ein Elektromeister dran. Man braucht bestimmte Befähigungen und Fachkenntnisse, und da kann die Feuerwehr noch so viele Aggregate haben, sie hat in der Regel nicht diese Leute und diese Ausrüstung dafür. Also die richtigen Fachleute spezialisiert. Das hat natürlich auch Nachteile. Nicht jeder kann alles machen, aber hochspezialisiert in Verbindung mit beruflichen Fähigkeiten oder besonderen Interessen. Das ist die Stärke des THW.
Das THW besteht zu 96 Prozent aus Ehrenamtlichen. Wie würden Sie einem Außenstehenden erklären, warum es sich dennoch lohnt, seine Freizeit fürs Technische Hilfswerk zu „opfern“?
Man lernt praktische Dinge, die man sonst nie lernen würde, manchmal aber auch privat gebrauchen kann. Ich sage mal Bootsfahrten, wenn man ein Ortsverband ist, der Boote hat. Man lernt die Teamarbeit oder die Kameradschaft. Das sind Dinge, die man in dieser Form auch im Berufsleben nur selten hat. Also ich kann nur sagen: Wie die Feuerwehr auch und das Rote Kreuz, da will ich keine großen Unterschiede machen, ist ein ehrenamtliches Engagement in einer Blaulichtorganisation ein Erlebnis!

Wie hat sich das THW, seitdem Sie eingetreten sind, verändert?
Wenn ich allein mal sehe, die Einsatzbekleidung, die wir damals hatten, das war so ein grauer Anzug, wir nannten ihn die graue Elise. Damit haben wir uns auch wohlgefühlt, da war das Abzeichen drauf vom THW, früher noch vom Zivilschutz. Und dann kamen die Neuen, die Blauen. Das war schon ein riesiger Fortschritt.
Also allein an der Kleidung kann man sehr viel erkennen. Die Qualität des Materials wurde auch mit der Zeit besser. Also zum Beispiel das Bohren eines Loches in ein Gestein. Da gab es früher den Bosch-Bohrhammer. Heute haben wir Betonkettensägen und Kernbohrer.
Ihnen ist das Thema Nachhaltigkeit und Umwelt wichtig. Wie gelingt nachhaltiger Katastrophenschutz?
Je nachhaltiger der Katastrophenschutz wäre, desto mehr würde auch in die Katastrophenvorsorge investiert. Das ist ein Teil des Katastrophenschutzes, vergessen viele, und desto überflüssiger würde der Katastrophenschutz in wesentlichen Teilen werden. Ganz überflüssig würde er aber nie. Insofern ist die Investition in Resilienz, in Nachhaltigkeit etwas, was sich nicht gleich rechnet. Deshalb wird es oft nicht gemacht, was aber dringend erforderlich ist, wenn wir nicht immer höhere Kosten in Kauf nehmen wollen durch Unwetterkatastrophen oder andere Unbilden.
Die Fakten zeigen, dass die Zahl und Intensität von Naturkatastrophen angesichts des Klimawandels rapide zunehmen. Wie wappnet sich das THW auf diese Situation?
Das THW war schon immer sehr konsequent. Das habe ich mit Respekt und Stolz mitverfolgt und auch mitgestaltet. Dass man aus Fehlern lernt, was viele andere ja nicht machen. Und z.B. hat das THW festgestellt, dass man mit einem Aluminiumboot oder gar mit einem großen Schlauchboot auf einem hochwasserführenden Fluss nichts zu suchen hat. Wenn irgendetwas in der Schiffsschraube drin ist, dann steht der Motor. Dann treibt das Schlauchboot hilflos im Hochwasser führenden Fluss ab. Das kann lebensgefährlich sein. Daher hat das THW nach dem ersten Elbehochwasser gesagt: Wir brauchen andere Boote, und hat dann eigentlich unsinkbare Doppelrumpfboote beschafft, mit zwei Motoren. Das hat das THW als Konsequenz dieser Erlebnisse, wo Gott sei Dank nichts schiefgegangen war, gezogen.

Sie bezeichnen das THW auch gerne als „Technisch Helfen Weltweit“. Welche Rolle spielt das THW im internationalen Katastrophenschutz?
Es ist ein sehr bekannter und geschätzter Partner. Nicht nur bei Katastrophen, sondern auch bei internationalen Wettbewerben, Ausbildungsveranstaltungen und Seminaren. Da habe ich in meiner Amtszeit viel dazu beigetragen, dass das THW sich dort regelmäßig zeigt und mitmacht. Das kostet natürlich Ressourcen, aber so eine Übung im Ausland ist auch immer ein Highlight für einen, der sich auf solche Einsätze eigentlich sonst nur vorbereitet.
Vor welchen Herausforderungen steht das THW heute?
Wir wissen nicht, was morgen passiert. Das THW selbst ist noch längst nicht so resilient, wie viele Leute es vielleicht erwarten oder wie es auch sinnvoll wäre. Also eine ideale Unterkunft, die es in dieser Form noch nirgendwo gibt, hat einen eigenen Brunnen, eine eigene Stromversorgung und auch Lebensmittel für alle Helfer und deren Familien für eine Woche eingelagert. Das nennt sich dann Resilienz.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft des THW?
Also erstmal wünsche ich mir, dass jeder Helfer und jede Helferin von jeder Übung, jedem Einsatz gesund nach Hause kommt. Das ist mal das Wichtigste. Dies kann man übrigens auch nur erreichen, wenn man das Thema Unfallverhütung und Sicherheitsmaßnahmen sehr hoch anhängt, was manche Leute dann stört, aber das muss eben so sein. Dann wünsche ich mir, dass das THW selbst immer resilienter wird, damit es auch anderen Bereichen, die das nicht geschafft haben, auch im Falle von großen Störungen, sei es Krieg, sei es Wetterunbilden, helfen kann. Außerdem lernte ich am Tag der offenen Tür Christoph Valentin, Ortsbeauftragter des THW-Verbands Friedberg, kennen.
Herr Valentin, wie kann man beim THW als Interessent starten?
Wir fangen an mit einer Grundausbildung, das heißt, ihr müsst beim örtlichen THW-Verband vorbeikommen. In der Regel dauert die Grundausbildung ein halbes Jahr. Danach geht es dann in die Einheiten. Da kann man dann auch direkt zu Einsätzen mit und bekommt auch noch eine Fachausbildung. In der Grund- und dann vor allem auch in der Fachausbildung erlernt man alles technische Wissen. Dann haben wir auch Bundesschulen, wo auch Lehrgänge angeboten werden.
Fazit: Das Technische Hilfswerk ist die Zivil- und Katastrophenschutzorganisation des Bundes. Mit ihren mehr als 88.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und 2.200 Hauptamtlichen leistet das THW, seit mehr als 70 Jahren, bemerkenswerte Arbeit für den Katastrophenschutz im In- und Ausland und damit für die gesamte Gesellschaft!
Text und Fotos: Paul Kiesow, Schüler der 12. Klasse in Hessen